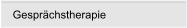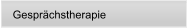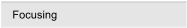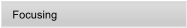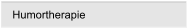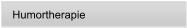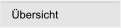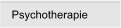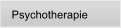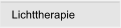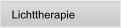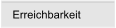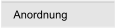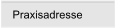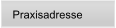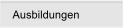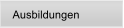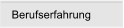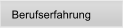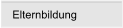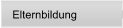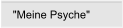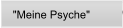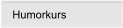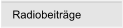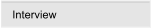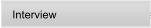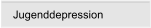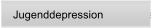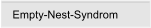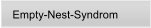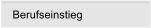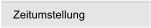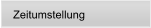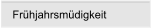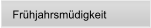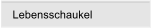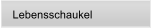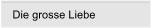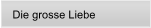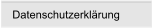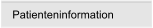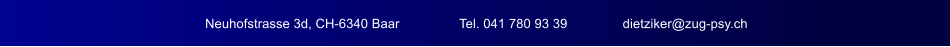

Moderne Grosseltern
Methoden
Person
Angebot
Thema
Kontakt
Artikel
Oma hat keinen Bock mehr
SonntagsZeitung vom 31. Januar 2016
Moderne Familien funktionieren oft nur, weil die Grossmutter einspringt. Doch wehe, sie möchte ihr eigenes
Leben führen
Von Bettina Weber
40 Jahre, hatte sie ausgerechnet: 40 Jahre lang war sie für andere da gewesen. Für die Familie, die drei Kinder, den Mann. Dann
wurde ihre Mutter krank; der Vater war überfordert, sie übernahm. Nach dem Tod der Mutter brauchte der Vater Betreuung, er
war hilflos, so allein, sie sprang ein. Mittlerweile waren die Kinder ausgeflogen, ihr Mann pensioniert. Sie machte weiterhin
den Haushalt, kochte. Dann erkrankte ihr Mann, es folgten zwei Jahre Pflege auch für ihn.
Nach seiner Beerdigung sass sie daheim, allein in der Stille, und stellte verwundert fest, dass sie keine Verpflichtungen mehr
hatte. Die ersten Monate waren hart, doch dann begann ihr diese neue Freiheit zu gefallen. Zum ersten Mal seit 40 Jahren
konnte sie tun und lassen, was sie wollte. Es war herrlich. Sie hatte das nie gekannt. Brigitte G. will nicht falsch verstanden
werden: Ihr Leben war gut. Schön. Erfüllt. Aber sie hat sich 40 Jahre lang zurückgenommen, alle anderen waren immer
wichtiger.
Als ihr ältester Sohn Vater wurde und sie zur Grossmutter machte, erklärte sie ihm in aller Ruhe, dass sie als regelmässige
Babysitterin nicht zur Verfügung stehe. Sie habe für ihren letzten Lebensabschnitt andere Pläne. Ihr Sohn war pikiert. Die
Schwiegertochter dachte, es liege an ihr. Deren Eltern fanden G. unmöglich. Die Nachbarn und die Freundinnen auch: Brigitte,
du kannst doch die Jungen nicht im Stich lassen!
Omas springen jährlich während 80 Millionen Stunden ein
Tatsächlich funktionieren moderne Familien, in denen beide Elternteile arbeiten – der Mann in der Regel Vollzeit, die Frau
höchstens in einem 50-Prozent-Pensum –, oft nur dank dem regelmässigem Hütedienst der Grosseltern. Genauer: dank der
Grossmütter. Gemäss dem Generationenbericht von 2008 springen die Omas jährlich während 80 Millionen Stunden ein, die
Jungfamilien verlassen sich darauf, sie rechnen sogar fest damit: Ein Tag pro Woche Kita, ein Tag die eine Grossmutter, ein Tag
die andere – das lässt sich organisieren und vor allem finanzieren.
Ihre Mütter sollen damit übernehmen, was Frauen von jeher machen: die Gratisarbeit, ohne die kein Haushalt zurechtkommt.
Auf zehn Milliarden Franken jährlich werden die Kosten geschätzt, für die Frauen Angehörige, betagte Familienmitglieder oder
eben Enkel unentgeltlich betreuen.
Pasqualina Perrig-Chiello, Psychologie-Professorin an der Uni Bern, die sich mit dem Thema Alter befasst, sagt: «Es heisst
immer, die Jungen müssten für die Alten bezahlen. Dass aber die Alten, und zwar allen voran die älteren Frauen, für Milliarden
Franken jährlich Gratisarbeit verrichten, davon spricht niemand.» Stattdessen heisst es: Sie macht es doch gern.
Ruth Fries, Mitbegründerin der sogenannten Grossmütter-Revolution – einem Projekt des Migros-Kulturprozents, lanciert von
aufmüpfigen Omas –, seufzt, wenn sie diesen Satz hört. «Interessanterweise hört man ihn immer nur, wenn es um Frauenarbeit
geht. Würden all die Männer, die ihren Job gern machen, auf ihren Lohn verzichten? Wohl kaum.»
«Es geht darum, dass unsere Arbeit weder wertgeschätzt noch vergütet wird»: Ruth Fries, Mitbegründerin der sogenannten
Grossmütter-Revolution. Die Selbstverständlichkeit, mit der Grossmütter sich um ihre Enkel kümmern sollen, ärgert sie.
Während ein Grossvater mit einem Enkel an der Hand Tränen der Rührung auslöst, wird automatisch davon ausgegangen, dass
sich das für eine Grossmutter so gehört.
Heidi Witzig, Historikerin und ebenfalls Mitglied der Grossmütter-Revolution, hütet ihren Enkel jeweils mittwochnachmittags.
Sie sagt: «Es macht mir wahnsinnig Spass. Aber mein Leben besteht doch aus mehr als bloss daraus, Oma zu sein.» Auch Ruth
Fries liebt ihre Enkel über alles. Aber sie hat mit ihrer Tochter von Anfang an eine Abmachung getroffen: «Du kannst jederzeit
fragen – aber ich entscheide.» So handhaben sie es bis heute.
Überforderung und der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung
Als Ruth Fries just dies letztes Jahr in der Sendung «Forum» auf SRF 1 sagte, sorgte ihre Aussage für Wirbel. «Wie kannst du
nur, Enkel sind doch das Schönste auf der Welt!», musste sie sich anhören, dabei war das doch gar nicht der Punkt. «Es geht
darum, dass unsere Arbeit weder wertgeschätzt noch vergütet wird. Der Staat – indem er Kinderbetreuung als Privatsache
betrachtet – und die Gesellschaft – die davon ausgeht, als ältere Frau habe man nichts anderes mehr vor im Leben, als Kinder
zu hüten – verlassen sich auf uns, profitieren gern von uns, aber mehr als ein Schulterklopfen gibt es dafür nicht. Das finde ich
nicht in Ordnung.»
Offenbar ist Ruth Fries nicht die Einzige, die das so sieht. Sie bekam nämlich neben aller Kritik auch unerwartet viel Zuspruch,
von regelmässig eingespannten Grossmüttern, die ihr schrieben: «Gut, hat das endlich mal eine gesagt. Ich hätte den Mut dazu
nicht.» Die Frauen berichteten von Überforderung durch die häufige Betreuung der Enkel oder einfach davon, dass sie sich
nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung sehnen würden.
Der Erwartungsdruck ist hoch, vielen Grossmüttern fällt es schwer, Nein zu sagen. Brigitte G. hatte dasselbe gehört, wenn auch
nur hinter vorgehaltener Hand. Denn während sich das Bild der Mutter als duldendes, aufopferndes Wesen langsam wandelt,
weil Frauen auch mit Kindern zunehmend einem Beruf nachgehen, bleibt das Klischee der Grossmutter bestehen. Pasqualina
Perrig-Chiello sagt es so: «Das Alter wird mit viel Negativem in Verbindung gebracht. Was sich positiv gehalten hat, ist das
Bild der liebenden, gütigen Oma, die immer für alle da ist und Zeit hat.»
Der Soziologe und Generationenforscher François Höpflinger sieht es ähnlich. Selbst dann, wenn Grosseltern Enkel gemeinsam
hüten würden, spiele die Grossmutter die zentrale Rolle, der Grossvater sei oft «einfach auch noch dabei»: «Die Grossmutter
wird als asexuelles Wesen ohne Bedürfnisse wahrgenommen. Und sie dient als rosa verzuckertes Bild eines bürgerlichen
Familienideals.» Sich dagegen zu wehren, fällt schwer, der Erwartungsdruck ist hoch. Die revolutionäre Oma Heidi Witzig
sagt: «Viele Frauen meiner Generation haben gelernt, dass sie dann geliebt werden, wenn sie brav und angepasst sind. Was sie
nicht gelernt haben, ist, Nein zu sagen und ihre Bedürfnisse zu artikulieren, eigenständig über ihr Leben zu entscheiden.»
Es brauche Mut, Nein zu sagen – wenn das Mami immer lieb und klaglos funktioniert habe, sei mit Irritation zu rechnen, wenn
sich dasselbe Mami mit einem Mal vermeintlich querstelle. Das ist das eine. Das andere, dass Frauen häufig noch berufstätig
sind, wenn sie Grossmütter werden, das Durchschnittsalter liegt bei 56 Jahren. Ruth Fries weiss, dass nicht wenige ihr Pensum
reduzieren, um den Kinderhütedienst zu übernehmen: «Das heisst, sie verdienen während fast zehn Jahren weniger und haben
deswegen später eine kleinere Rente. Das ist verheerend.» Und die Frage stellt sich: Wieso reduzieren eigentlich nicht die Väter
ihr Pensum?
Gleichberechtigtes Frauenbild nicht für Omas
Brigitte G. musste sich ebenfalls verteidigen, rechtfertigen auch, und es verletzte sie. «Man fand es immer bewundernswert,
wie ich mich um meine Eltern und dann um meinen Mann kümmerte. Bewundernswert, aber eben auch selbstverständlich. Das
war es für mich auch. Dennoch habe ich viele Kompromisse gemacht. Ich möchte die letzten zwanzig Jahre meines Lebens so
verbringen, wie es die jungen Frauen heute für sich in Anspruch nehmen. Und ich finde: Daran ist nichts verwerflich.»
Das sehen aber gerade die Töchter oft nicht so. Deren Unverständnis geht mitunter so weit, dass sie beleidigt den Kontakt
abbrechen oder mit dem Entzug der Enkel drohen, wenn die Grossmütter sich erlauben, nicht nach Stundenplan zur Verfügung
zu stehen.
Manchmal erklären sie den bockigen Omas auch unumwunden, in diesem Fall könne diese dann nicht damit rechnen, dass man
sich um sie kümmere, sollte sie je pflegebedürftig werden. Anders gesagt: Gerade die jungen Männer und Frauen, die gleich-
berechtigter leben wollen als ihre Eltern, erwarten von ihren Müttern und Schwiegermüttern ganz selbstverständlich, dass diese
sich ins alte Rollenbild fügen.
Seit Kinder zum Projekt geworden sind, hat sich die Situation zusätzlich verschärft. Grossmütter, die keine Lust haben, sich zu
fixen Zeiten um den überbehüteten Nachwuchs zu kümmern, werden erst recht als Affront empfunden, als persönliche Zurück-
weisung. Selbstbestimmung finden alle gut. Und wichtig. Bloss Grossmütter sollen sich doch bitte nicht erfrechen, diese für
sich in Anspruch zu nehmen.
zurück
Datenschutz